KULTURINDUSTRIE 2.0 oder: DIGITALER PRIAPISMUS

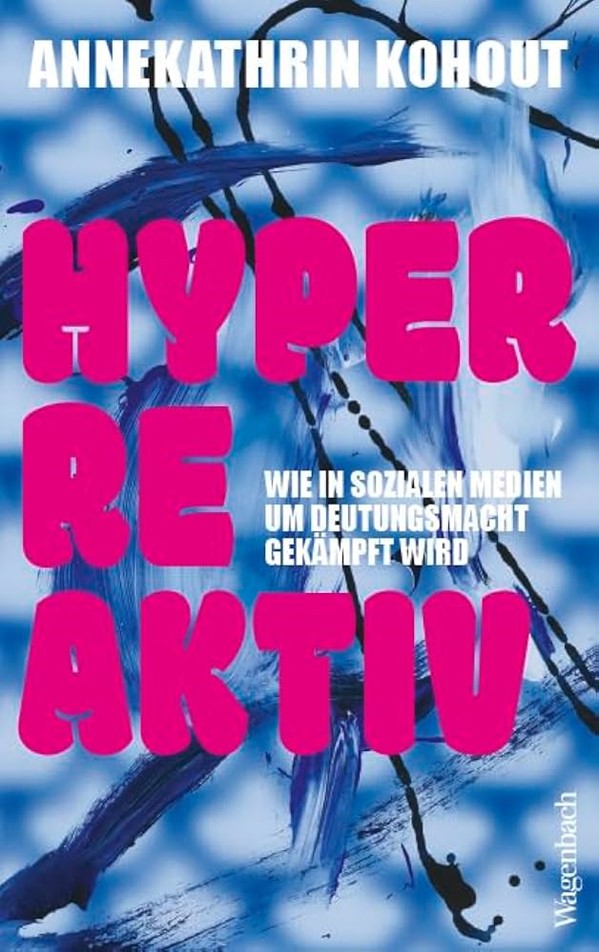
Annekathrin Kohouts Hyperreaktiv ist ein kluges, pointiertes Buch über kommunikatives Handeln (und d.h. zumeist: Reagieren, shit- oder candystorm) in der digitalen Welt der Social Media. Kohout beschreibt, wie Likes, Shares und Kommentare zur neuen Währung gesellschaftlicher Bedeutung in diesem Universum geworden sind, und wie diese Mechanismen unsere (auch analogen) Diskurse, unsere Kultur und unser Selbstverständnis deformieren: Wir leben in einer Reaktionskultur, in der nicht mehr das Gesagte zählt, sondern die Resonanz darauf. Klicks statt Inhalt, Polarisierung, Etikettierung und Beifall oder Buhrufe statt Verständigung. Wer differenziert, verliert.
Kohout benennt die Symptome der digitalen Dauererregung: Hyperinterpretation, Polarisierung, Kontrollverlust. Aus meiner Sicht bleibt indes die Kritik an den ökonomischen und ideologischen Grundlagen dieser Plattformlogik unterbelichtet. Vor einigen Jahren wäre z.B. die Figur des Influencers, der über seine „Reichweite“ seinen Lebensunterhalt bestreitet und gleichzeitig seinen Sponsoren einen neuen Absatzmarkt eröffnet, nicht möglich gewesen. Die Plattformen erscheinen in Kohouts Buch als technische Umgebungen, nicht als ökonomisch getriebene Machtapparate, die die Öffentlichkeit systematisch formatieren und so zu einem neuen „Strukturwandel“ dieser Öffentlichkeit geführt haben.
Kohouts Beschreibung des „fiebrigen Zustands“ bleibt psychologisch, kaum gesellschaftskritisch. Die Reaktionskultur erscheint als bloßes kulturelles Phänomen, nicht als Ausdruck einer verwalteten Welt.
An diesem Punkt stellt sich die Frage, ob Kohouts Analyse nicht selbst Teil jener Reaktionskultur ist, die sie kritisiert. Erkenntnis allein genügt nicht, wenn sie nicht zur Veränderung führt.
Dennoch: Kohouts Appell zur digitalen Selbstverantwortung und Souveränität in der Welt der Social Media ist wichtig. Ihr Plädoyer, auch mal nicht zu reagieren, ist ein stiller Akt der Verweigerung – und damit vielleicht der erste Schritt aus der Logik der Plattformen heraus. Lässt man sich auf die Reaktionskultur jedoch ein, fordert die Autorin zurecht ein zivilisierendes Bewusstsein, denn: Wer reagiert, trägt Verantwortung. Wer teilt, formt Diskurse. Wer klickt, setzt Prioritäten.
Doch wer die Totalität der Verhältnisse verstehen will, muss tiefer graben: hinter die Algorithmen, in die Ökonomie, in die Ideologie.
Hyperreaktiv ist ein notwendiges Buch – aber nicht das letzte Wort. Es ist ein Anfang für eine breitere, radikalere Gesellschaftsanalyse, die sich nicht mit Symptomen zufriedengibt, sondern die Ursachen freilegt.
