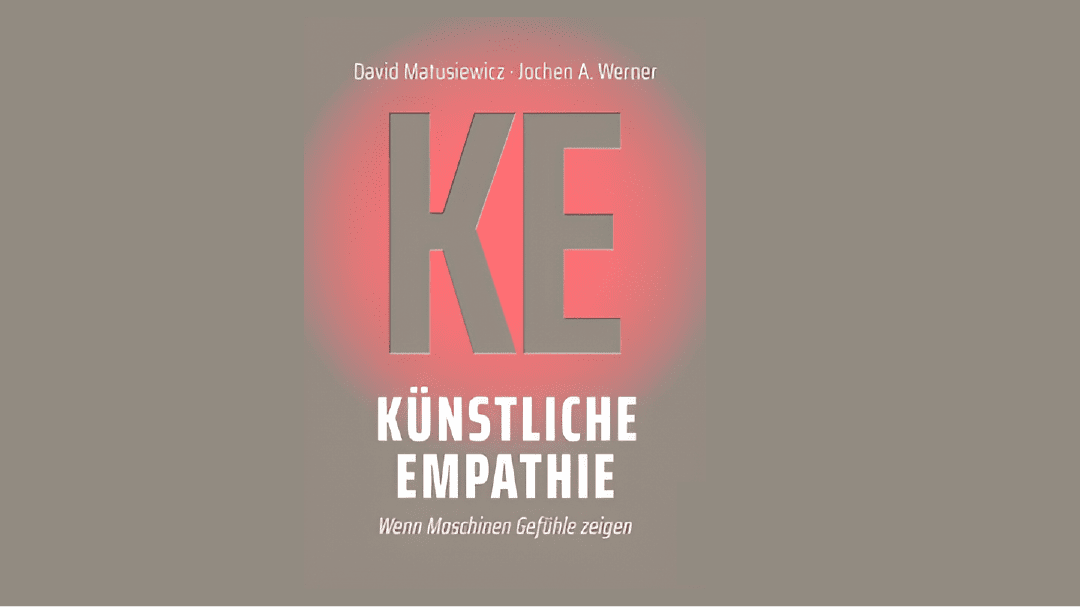
Der Eyecatcher des Akronyms KE setzt sich in dem semantischen Braincatcher fort, sobald man sich vorzustellen versucht, was mit »künstlicher Empathie« gemeint ist.
Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin, denn dieses Oxymoron exemplifiziert selbst, wofür es titelgebend steht und womit die Abkürzung als Gegenbild zu „KI“ spielt.
Der Untertitel: „Wenn Maschinen Gefühle zeigen“ provoziert vermutlich bei dem, der das Buch in einem Laden zufällig in die Hand nimmt, eine erste Irritation: wenn Technik „Gefühle“ zeigen oder Algorithmen Gefühle simulieren: sind es „echte“ Gefühle? und ist so etwas neu?
Man könnte sagen: jede gut gemachte Werbung spielt damit und bedient emotionale Erwartungen. Jede gute Schauspielerin – ein Mensch, der aber doch nicht sich selbst, sondern etwas anderes darstellt und eine Rolle verkörpert – zeigt Gefühle. In beiden, uns so vertrauten, Beispielen sind die Gefühle nicht „echt“ in dem Sinne, dass sie authentisch wären, aber: in der Werbung wie im Kino „funktionieren“ gut gemachte unechte Gefühle: wir kaufen und wir lachen oder weinen.
Der Unterschied zu dem, was Matusiewicz und Werner verhandeln, ist, dass im Fall des Kinos erlernte und trainierte schauspielerische Fähigkeiten, aber jedenfalls das Talent eines Menschen, und im Fall von Werbung werbepsychologische Erfahrungen und Tricks zur Wirkung kommen.
Matusiewicz und Werner illustrieren das, was neu ist, mit Robotern, Sprachassistenten und Bots und dies in diversen Szenarios. Und auch wenn die Algorithmen von Menschen geschrieben worden sind, sind jene in der Lage, sich selbst zu optimieren und weiterzuentwickeln und letztlich von diesen zu emanzipieren.
Vermutlich kennen inzwischen alle, die sich für die Defizite von Gesundheitssystemen interessieren, die humanoid aussehenden Roboter in der Pflege, v.a. „Pepper“ aus Japan (wo die Anzahl der offiziell pflegebedürftigen Menschen rund doppelt so hoch wie in Deutschland ist), und haben bereits kontroverse Diskussionen darüber geführt, ob man Pflegeroboter kritisieren muss oder für ihre zunehmende Verhaltens- und Kulturkompetenz feiern.
Das, was Matusiewicz und Werner völlig zurecht feststellen, ist: es ist möglich, und es „funktioniert“, und zwar unabhängig davon, ob man menschliche Pflegekräfte für besser und wünschenswerter hält: einfach, weil diese nicht (mehr) verfügbar sind: in hinreichender Anzahl, mit der notwendigen Ausbildung und zu bezahlbaren Konditionen.
Die billige Pflegekraft aus dem Ausland ist nur die Vorstufe.
Es gibt, grob gesagt, im Gesundheitssystem Service-Roboter und sozio-assistive Roboter.
Für die apriorischen Verächter von „KE“ gilt, dass sie sich Roboter wie den AV1-Avatar in Aktion ansehen sollten: dieser wird nämlich eingesetzt, um Kindern mit einer Langzeiterkrankung soziale Kontakte und Teilhabe zu ermöglichen. Dies ist insofern ein bedenkenswertes Beispiel, weil der Avatar in diesem Fall soziale Kontakte und Teilhabe üben und wieder vorbereiten soll: anstatt sie überflüssig zu machen.
Letzteres stellt sich – und darauf sollten die Bewunderer von „KE“ sehen – bei „digitaler“ Liebe anders dar. Vielleicht hätte man in diesem Kapitel des Buchs von Matusiewicz und Werner die soziologische Dimension näher erörtern und diskutieren sollen: Der Witz ist nicht so sehr, dass es Bordelle mit Gummipuppen gibt (und dieses Geschäftsmodell sich tatsächlich rechnet). Das quasi Disruptive ist, dass sich Gefühlsbeziehungen zwischen Mensch und Maschine (jenseits eines Fetischcharakters) entwickeln können („Ich bin dein Mensch“ nutzt diesen Plot), dass dies möglich ist, „Liebe“, und dass ernsthafte Überlegungen zu den Pros und Contras derartiger „Beziehungen“ möglicherweise in Zukunft notwendig sind, weil empathische Roboter*innen das Zusammenleben mit und von Menschen verändern könnten.
Dies führt schließlich die Überlegungen zu empathischen maschinellen Systemen zu einem Punkt, an dem viele revolutionäre technologische Entwicklungen einmal gestanden haben und stehen: ihr Einsatz kann überaus positive, aber, sofern er nicht von der Verantwortung des Erfinders und unserer Gesellschaft überprüft wird, auch negative Folgen zeitigen.
Es ist das alte Spiel wie in Dürrenmatts „Physikern“, wo es um die zwiespältige Anwendung der damals neuen Erkenntnisse ging: als Reaktor oder Bombe.
Das Buch von Matusiewicz und Werner greift dieses Thema, künstliche Intelligenz im Gesundheitssystem und bei der Versorgung, auf und führt zu einer entscheidenden Frage: Was wollen wir im Einzelnen und was möglicherweise nicht? Was ist in Zukunft ganz unverzichtbar und was ist 1984?
Das Verdienst dieses Buches ist es, für derartige Weichenstellungen eine Art Keynote Lecture zu liefern, und man möchte ihm eine breite Diskussion wünschen.
